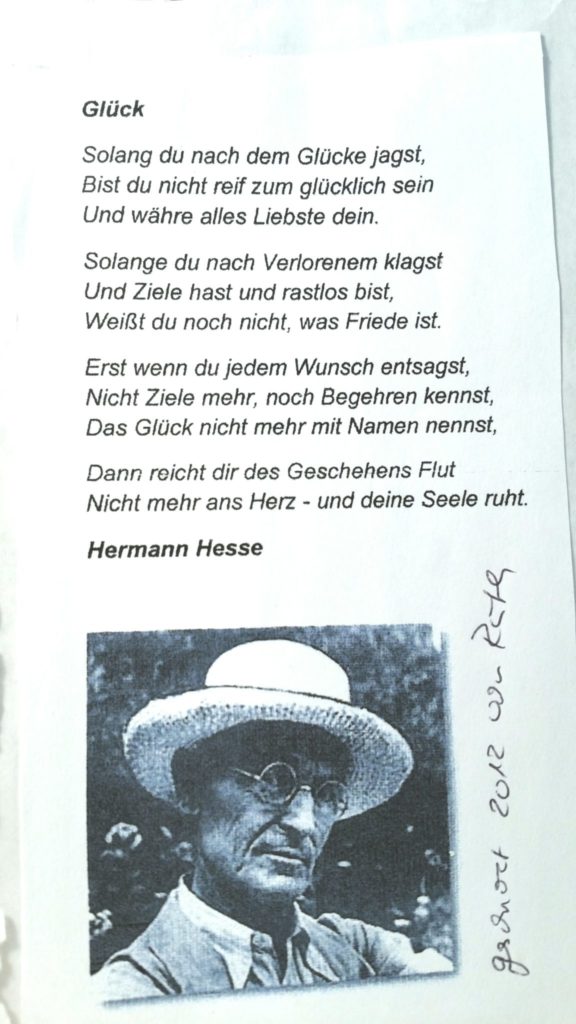Es war die ständige Vibration zusammen mit dem unrhythmischem Schaukeln, die während der Fahrt eines Zuges auf altgedientem Gleisbett entsteht und im ganzen Körper spürbar ist. Sie hilft mir eine Skizze zu zeichnen, wie es mir ergeht zur Zeit.
Unterwegs zu sein, besonders auf einer Weitwanderung, lässt mein Leben leise im Takt der verlässlichen, rhythmischen Schritte fließen. Es ist passiv in Bewegung. Entgegen der Vorstellung, es sei anstrengend, brauche ich nicht viel zu tun. Ich kann mich einfach gehen, manchmal auch spüren oder sogar sein lassen. In ständig neuem Licht zieht die Landschaft vorbei, alles kommt und geht. Es ist warm, kalt, feucht, steil oder steinig. Ich sehe mal klar, mal trüb.
Ich nehme es an.
Spüre ich auch manchmal den Schmerz der Stille und der Sehnsucht, trägt mich der Weg doch immer wieder weiter.
Ich habe Vertrauen.

Am Haltepunkt aber wird es still und was zu spüren ist, bin nur noch ich selbst. Zähe Leere. Schwarz verklebt. Es ist keine Landschaft mehr auszumachen. Der Atem stockt. Es riecht nach Vergangenem. Schräge, gezogene, meist dumpfe Töne dringen von außen in mein Ohr. Irgendwas will mich glauben lassen, ich müsse es mir zuhalten.
Alles fällt schwer.
Irgendwie in Bewegung bleiben.
Mir selbst einen Weg bahnen.
Einen ganz neuen.
Hoffen.
Auf die Lust, die Neugierde, die Farben, Wind und Sonne, das Lachen.
Auf das knirschende Geräusch, das beim Vertrauen in den nächsten Schritt entsteht.