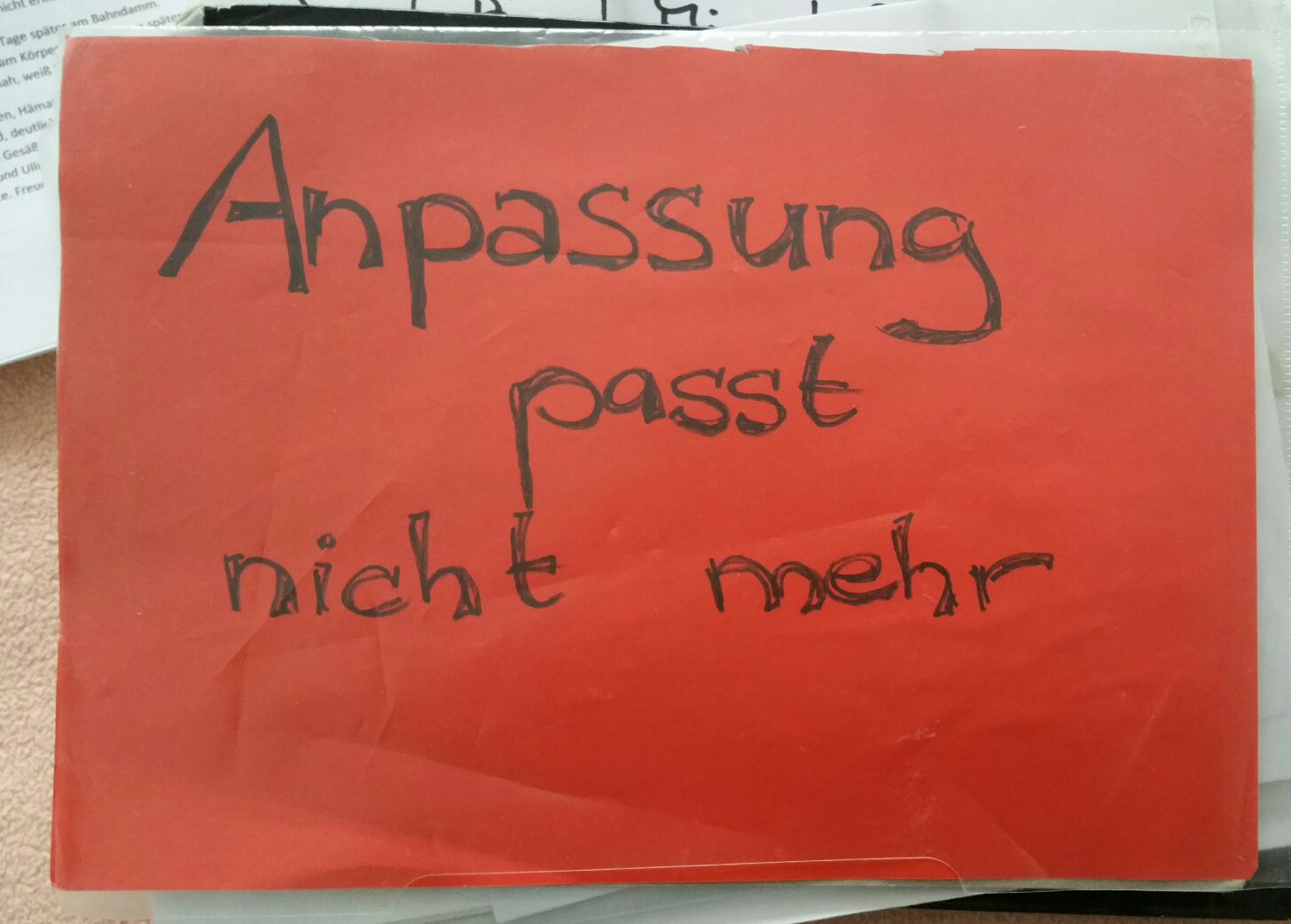Es ist nicht so, dass ich mir sie als mir zugehörig zuschriebe, nein.
Aber ich kann sie gerade fühlen.
Ich konnte sie in dem Spiegel des fünfköpfigen Therapeutenteams finden, den sie mir vorhielten.
Ich war sehr aufgeregt wegen dieses Termins.
Es gehört zum Therapiekonzept, dass Menschen, die stationär DBT nach den Richtlinien des Dachverbandes machen, nach einer Eingewöhnungsphase dem Großteam eine den vorgegebenen Fragen folgende, aber selbstverfasste Verhaltensanalyse über ihr zentrales Problemverhalten vorstellen. Das Team trifft dann eine Entscheidung, ob eine weitere DBT Behandlung in ihrem Rahmen zum derzeitigen Zeitpunkt sinnhaftig ist und dementsprechend fortgeführt werden wird – oder eben nicht.
Alleine das Problemverhalten zu benennen war eine schwere Geburt. „Butter bei die Fische“, beriet ich mich hinterntretend ermutigend und quälte mich vorletztes Wochenende anhand des Themas „Ich bin /gebe mir /suche überall Schuld / mache mich schuldig“ durch die Fragestellungen. Aber mein Stolz über die schonungslose Selbstoffenbarung wurde nicht bestätigt, sondern meine Abhandlung als „am Thema vorbei“ gewertet: Ich müsse einen konkreten Vorfall betrachten, wobei mir dringend der Suizidversuch und am besten zudem noch ein aktuelles Problemverhalten im Rahmen der Therapie, also insgesamt zwei Analysen, zu verfassen empfohlen wurde.
So verbrachte ich alle Zeit des zurückliegenden Wochenendes, die ich damit aushielt, mit eingehender, so ehrlich wie mir möglicher Nabelschau und dem Sortieren, Formulieren und Zusammenfassen von dem, was ich da so vorfand.
Um 11 Uhr saß ich heute dann auf dem Flurboden vor dem Arztzimmer und versuchte häkelnd meine Wut über die Verspätung einzelner Therapeuten niederzuringen.
Endlich war es soweit. Ich trug die Verhaltensanalyse vor. Anhand der Fragen und konkreten Rückmeldungen der ZuhörerInnen konnte ich mir die Glaubwürdigkeit zu spüren erlauben, die Analyse sei mir kompetent gelungen.
Nach einer kurzen Beratungszeit hieß man mich „in der DBT willkommen“.
Ein gutes Gefühl.
Ich gehe aufrecht. Habe offene Augen. Sehe, wer da ist.
Fühle mich ‚alswesend‘.
Ich kann ja (was) – sein.
Ein Gefühl, das mir fehlt, um da zu sein.
Ja, so kompliziert ist es zu sein möglich.
Noch mehrmals habe ich im Verlauf des Tages von Mitarbeitern gehört, dass man von meiner Aufarbeitung beeindruckt gewesen sei. Man habe das in der Übergabe gehört. Mir wurde dazu gratuliert. Und – nein – es sei nicht selbstverständlich, das man weiter am Programm teilnehmen dürfe.
Ich gebe zu, das macht mich schon ein bisschen stolz in der Hinsicht: „Auch wenn Du es nicht richtig verstehst, scheinst Du den Weg richtig zu gehen“.
Dieses wache, so zufriedenstellende, wach seiende, irgendwie erwachsene Gefühl hatte ich bereits zwei Mal während meiner Zeit in dieser Klinik.
Da war die Hippotherapie. Der kleine, noch etwas eigenwillige Halbwüchsige machte das mit, wozu ich ihn aufforderte. Er kaute. Ein Zeichen von Pferden, wenn die Kommunikation stimmt und er sich wohl fühlt, wurde mir von der Therapeutin gesagt. Das freute mich wirklich zutiefst.
Und da war Mitpatient ‚Franz‘ (nenne ich ihn mal). „Über dem Strich“. Hatte wohl eine durchwachte Nacht hinter sich und fühlte sich von den Pflegern missverstanden. Ich blieb. Er war aufgebracht und hatte viel zu sagen. Versuchte zu hören, was er zwischen den Worten sagt. Hatte das Gefühl, das wir uns auf einen Sendeempfangskanal einigen konnten. Es wurde ärmer an Worten und reicher an sowas wie Vertrauen. Wir konnten einen Moment zusammen schweigen.
Ich nenne sowas ein Geschenk.
Ich bin ganz schön lange aus dem Geschäft und mir fehlen diese Momente des „Einfach und gleichzeitig richtig seins“.
Wird Zeit, dass ich so einen Platz wieder finde für mich und meinen Chor.